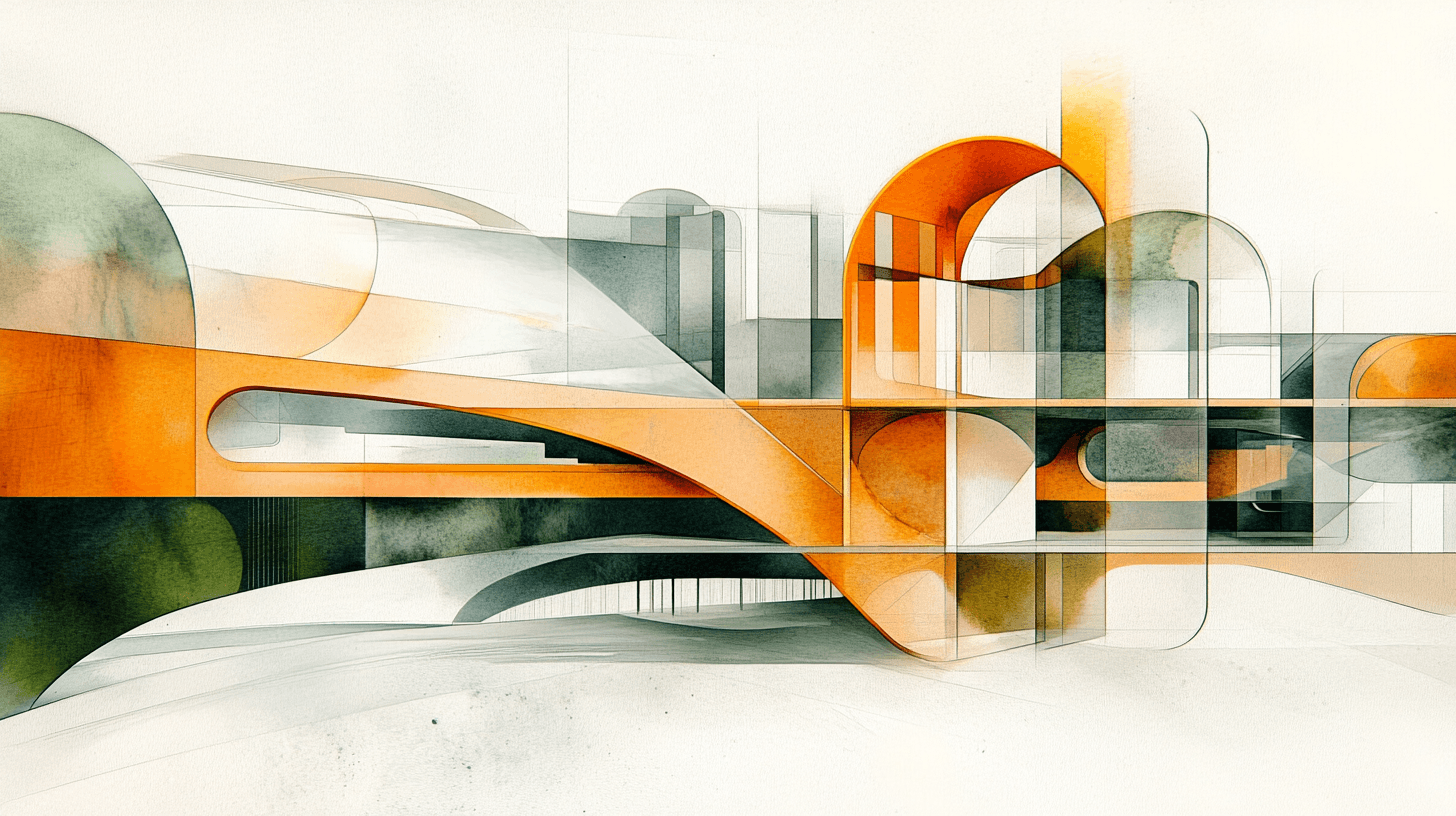This article is also available in: English
Vor kurzem habe ich mit dem Management-Board eines etablierten Versicherungsunternehmens zusammengearbeitet, das davon überzeugt war, dass seine Organisation keine Zukunft hat. Ihre Branche veränderte sich rapide und sie sahen sich als Verwalter eines unvermeidlichen Niedergangs. Doch nachdem sie die Herausforderungen der Zukunft in ihrem Bereich analysiert und mit den Stärken ihrer Organisation abgeglichen hatten, geschah etwas Bemerkenswertes: Ihre Perspektive änderte sich um 180 Grad. Sie entdeckten nicht nur Möglichkeiten, zu überleben, sondern auch, etwas zu bewegen und zu wachsen. Dieser dramatische Wandel in der Zukunftsorientierung ist nicht auf veränderte Marktbedingungen oder die Entwicklung neuer Kompetenzen zurückzuführen, sondern auf eine bewusste Auseinandersetzung mit Zukunft und der Art und Weise, wie sie in der Organisation genutzt wird.
Die Macht impliziter Erzählungen über die Zukunft
Diese Erfahrung veranschaulicht eine wichtige Erkenntnis: Jede Organisation hat eine implizite Art und Weise, mit der Zukunft umzugehen, die ihre Kultur, ihre Entscheidungsfindung und ihr Verhalten tief prägt. Die Zukunft ist eine starke Kraft im Leben einer Organisation und beeinflusst alles, vom täglichen Betrieb bis hin zu langfristigen Investitionsentscheidungen. Die meisten Organisationen sind sich jedoch nicht bewusst, wie sie Narrative über die Zukunft erzeugen und nutzen, so dass diese einflussreiche Kraft weitgehend unerforscht und unkontrolliert bleibt.
Stell dir vor, du kommst in eine Management-Sitzung und das Gespräch dreht sich ständig um die Themen „mit der Konkurrenz mithalten“ oder „sich gegen Disruption wehren“. Dann stelle dir einen anderen Sitzungssaal vor, in dem Diskussionen über die „Gestaltung der Zukunft, die wir uns wünschen“ oder die „Gestaltung des Wandels in der Branche“ im Mittelpunkt stehen. Diese gegensätzlichen Ansätze offenbaren mehr als nur unterschiedliche strategische Perspektiven – sie erzeugen unterschiedliche organisatorische Dynamiken und Verhaltensweisen, die oft zu sich selbst erfüllenden Prophezeiungen werden. Ein angstbesetztes Verhältnis zur Zukunft führt in der Regel zu defensiven, reaktiven Strategien, während positive Zukunftserzählungen in der Regel innovativere, proaktivere Ansätze ermöglichen.
Diese unbewusste Dynamik explizit zu machen – und bewusst zu gestalten – ist ein mächtiger, aber weitgehend ungenutzter Hebel für die Organisationsentwicklung. Zu verstehen, wie die eigene Organisation derzeit die Zukunft nutzt, und eine bewusste Entscheidung darüber zu treffen, wie die Zukunft genutzt werden soll, kann die Effektivität und die Kultur der Organisation grundlegend verändern.
Die gegenwärtigen Rollen der Zukunft verstehen
Um zu verstehen, wie Zukunftserzählungen das Verhalten von Organisationen beeinflussen, wollen wir die häufigsten Rollen untersuchen, die Organisationen der Zukunft zuschreiben. Diese Rollen zeigen grundlegende Unterschiede in der Art und Weise, wie Organisationen ihre Beziehung zu Wandel und Unsicherheit wahrnehmen.
Die angstbasierte Zukunft
Viele etablierte Organisationen, insbesondere in traditionellen Branchen, nutzen die Zukunft vor allem als Drohkulisse. „Wenn wir mit der Digitalisierung nicht Schritt halten, verlieren wir Marktanteile.“ “Unsere Wettbewerber sind innovativer – wir müssen aufholen.“ Diese Rolle ist besonders in Krisenzeiten oder bei schnellen Veränderungen in der Branche üblich. Während sie kurzfristig ein Gefühl der Dringlichkeit erzeugen kann, führt sie oft zu reaktiven Entscheidungen und kulturellen Ängsten.
Diese Rolle ist besonders ausgeprägt bei gemeinnützigen und aktivistischen Organisationen, wo die Drohung mit einer negativen Zukunft („wenn wir jetzt nicht handeln …“) zu einem Hauptinstrument der Spendenwerbung und der Mobilisierung von Unterstützung wird. Diese Rolle führt jedoch in der Regel nur zu einem vorübergehenden Engagement, da die ständige Konfrontation mit einer bedrohlichen Zukunft zu Ermüdung und Desinteresse führen kann.
Eine erstrebenswerte Zukunft
Im Gegensatz dazu haben viele Start-ups und Technologieunternehmen eine grundlegend andere Einstellung zur Zukunft. Ihre Geschichten drehen sich um positive Veränderungen: „Wir entwickeln Technologien, die das Gesundheitswesen revolutionieren werden“ oder „Unsere Plattform wird Finanzdienstleistungen demokratisieren“. Diese ehrgeizige Rolle schafft eine starke Motivation, indem er die tägliche Arbeit mit einer überzeugenden Vision positiver Veränderungen in Einklang bringt.
Diese Organisationen schöpfen nachhaltige Energie aus ihrer Zukunftsvision und nutzen sie, um Talente anzuziehen, Entscheidungen zu treffen und die Dynamik auch in schwierigen Zeiten aufrechtzuerhalten. Die Zukunft wird nicht zu einer Bedrohung, die es zu vermeiden gilt, sondern zu einem Ziel, das es zu erreichen gilt.
Die in der Vergangenheit verankerte Zukunft
Eine dritte Rolle zeigt sich bei Organisationen mit einer starken historischen Identität. Diese Organisationen sehen ihre Zukunft oft durch die Brille ihrer Vergangenheit und halten den Niedergang für unvermeidlich: „Die besten Tage unserer Branche liegen hinter uns“. Dieses Narrativ schränkt Innovation und Anpassung gerade dann ein, wenn sie am dringendsten benötigt werden.
Die Vielfalt der Zukunftsrollen
Obwohl diese drei Rollen häufig zu beobachten sind, entwickeln Organisationen in der Regel ihre eigenen einzigartigen Ansätze, bei denen häufig mehrere Elemente kombiniert werden. Ein Technologieunternehmen könnte nach außen eine hoffnungsvolle Zukunft projizieren, während es intern mit angstbesetzten Narrativen arbeitet. Branchenkontext, Organisationsgeschichte, Führungsstil und kultureller Hintergrund prägen diese Rolle und machen das Verhältnis jeder Organisation zur Zukunft einzigartig.
Auswirkungen auf das Verhalten der Organisation
Diese unterschiedlichen Rollen für die Zukunft manifestieren sich in konkreten Verhaltensweisen der Organisation:
- Wie Chancen bewertet werden
- Wo Ressourcen zugewiesen werden
- Wie Erfolg gemessen wird
- Welche Verhaltensweisen belohnt werden
- Wie Risiken wahrgenommen und gemanagt werden
Am kritischsten ist die Tatsache, dass diese Rollen dazu neigen, sich selbst zu verstärken. Organisationen, die angstbesetzte Zukunftsnarrative verwenden, entwickeln oft eine risikoscheue Kultur, die die defensive Positionierung noch verstärkt. Umgekehrt ziehen Organisationen mit ehrgeizigen Zukunftserzählungen eher optimistische und innovative Talente an, die ihre zukunftsorientierte Kultur stärken.
Die Macht unbewusster Rollen

Was diese Rolle besonders mächtig macht, ist ihre unbewusste Natur. Wie Fische, die nicht merken, dass sie im Wasser schwimmen, erkennen Organisationen selten, wie ihre implizite Nutzung der Zukunft ihre gegenwärtige Realität prägt. Dieser nicht wahrgenommene Einfluss erstreckt sich über die formale Strategie hinaus auf den täglichen Betrieb, die Teamdynamik und die individuelle Entscheidungsfindung.
Das Verständnis dieser Rollen ist der erste Schritt zu einer gezielteren und effektiveren Nutzung von Zukunftserzählungen in der Organisationsentwicklung. Wenn du erkennst, wie deine Organisation derzeit die Zukunft nutzt, kannst du damit beginnen zu bewerten, ob dieser Ansatz deinen langfristigen Zielen und deiner Kultur dient.
Von der Herausforderung zur Transformation
Die Neugestaltung der zukünftigen Ausrichtung einer Organisation erfordert eine Navigation durch komplexes kulturelles und psychologisches Terrain. In meiner langjährigen Arbeit mit Management-Teams habe ich festgestellt, dass eine nachhaltige Transformation von zwei entscheidenden Veränderungen abhängt: der Überwindung einer auf Bedrohung basierenden Motivation und der Entwicklung einer authentischen Fähigkeit, Ziele zu erreichen.
Die erste Herausforderung besteht darin, davon wegzukommen, die Zukunft in erster Linie als Bedrohung zu sehen („innovate or die“), um kurzfristige Dringlichkeit zu erzeugen. Dieser Ansatz mag zwar zu sofortigem Handeln verleiten, verstärkt aber letztlich defensive Verhaltensmuster und schränkt strategisches Denken ein. Ein CEO sagte ganz offen: „Ich habe meine ganze Karriere damit verbracht, auf Bedrohungen zu reagieren. Wenn du mich fragst, wie ich mir die Zukunft vorstelle, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie ich anfangen soll.
Die zweite Herausforderung geht über die Veränderung der individuellen Denkweise hinaus. Selbst wenn Führungskräfte mit überzeugenden Visionen für positive Veränderungen antreten, stoßen sie oft auf unerwarteten Widerstand. Die in der Organisation verankerte Rolle der Zukunft, die sich über Jahre oder Jahrzehnte entwickelt hat, prägt weiterhin das Verhalten auf allen Ebenen und unterminiert oft unsichtbar neue Initiativen.
Wandel durch geduldige Führung
Eine wirksame Umgestaltung erfordert einen differenzierteren Ansatz als nur die Festlegung neuer Leitlinien oder die Einführung neuer Prozesse. Stellen Sie sich Organisationen vor, in denen jede strategische Entscheidung durch eine Worst-Case-Planung gefiltert wird. In einem solchen Umfeld ist es selten erfolgreich, einfach „mehr Innovation“ oder „kreatives Denken“ zu fordern. Stattdessen beginnt eine nachhaltige Veränderung mit der Entwicklung der Fähigkeit von Führungsteams:
- Bestehende Rollen erkennen, ohne zu werten
- Die historischen und kulturellen Ursprünge dieser Rolle verstehen
- Schrittweise alternative Wege der Zukunftsorientierung einführen

Die erfolgreichsten Veränderungen spiegeln die Geduld und Weisheit einer geschickten Kultivierung wider. Effektive Führungskräfte sind wie Meistergärtner:
- Sie verstehen ihr organisatorisches „Terrain“ sehr gut – den kulturellen Kontext, in dem Veränderungen wachsen müssen.
- Sie wählen neue Ideen sorgfältig aus und pflanzen sie dort ein, wo sie am ehesten Wurzeln schlagen können.
- Sie fördern neu entstehende Rollen und respektieren gleichzeitig die bestehenden Stärken der Organisation.
- Sie schaffen geschützte Räume, in denen neue Ansätze ohne unmittelbaren Ergebnisdruck entwickelt werden können.
Dies könnte bedeuten, mit gezielten Experimenten zu beginnen, in denen Teams üben, Risikobewertung und Chancenerkundung miteinander in Einklang zu bringen, oder regelmäßige Foren einzurichten, in denen längerfristige Möglichkeiten außerhalb des Drucks unmittelbarer Umsetzungserfordernisse diskutiert werden können.
Bewusste Zukunftsorientierung schaffen
Es ist nicht mehr optional zu verstehen, wie deine Organisation die Zukunft nutzt. Aus verständlichen Gründen greifen Organisationen häufig auf angstbasierte Rollen zurück – sie agieren in zunehmend komplexen Umgebungen, in denen Bedrohungen unmittelbar und konkret erscheinen, während Chancen weit entfernt und ungewiss erscheinen. Der quartalsweise Druck auf die Geschäftszahlen verstärkt dieses kurzfristige, defensive Denken noch. Doch in einer Welt, die sich immer schneller verändert, können diese unbewussten Rollen, die in der Vergangenheit hilfreich waren, jetzt dein Potenzial einschränken.
Der Wandel beginnt bei der Führung, geht aber weit über individuelle Denkweisen hinaus. Wenn Führungskräfte Schwierigkeiten haben, positive Zukunftsperspektiven zu artikulieren, überträgt sich dieses Zögern auf die gesamte Organisation. Teams greifen diese Unsicherheit auf und verstärken defensive Muster der Entscheidungsfindung, der Ressourcenallokation und der Innovationsbemühungen.
Der Schlüssel liegt darin, zu erkennen, dass die Beziehung deiner Organisation zur Zukunft nicht nur eine Frage der formalen Strategie ist – sie ist tief in deiner kulturellen DNA verwurzelt. Diese Beziehung prägt nicht nur die Art und Weise, wie geplant wird, sondern auch das tägliche Handeln: Welche Ideen werden unterstützt, welche Risiken werden als akzeptabel empfunden und letztlich, welche Zukunftsperspektiven werden als möglich wahrgenommen.
Die Frage ist nicht, ob die Zukunft eine wichtige Rolle im Leben deiner Organisation spielt – sie tut es. Die Frage ist vielmehr, ob diese Rolle von unbewussten Mustern oder von bewusster Gestaltung geprägt sein wird. Die Entscheidung – und die Chance – liegt darin, diese entscheidende Dimension der Organisationsentwicklung anzugehen.
Ins Handeln kommen
Wenn du daran interessiert bist, die Rolle von Zukunftsnarrativen in deiner Organisation zu untersuchen und bewusst zu gestalten, dann beginne hier:
- Beobachte, wie Zukunftsnarrative in deinem Alltag auftauchen. Achte darauf, wie Mitarbeitende und Teams über Veränderungen, Chancen und Risiken sprechen. Welche Muster fallen dir auf?
- Über das eigene Verhältnis zur Zukunft nachdenken. Wie bezieht man sich als Führungskraft auf die Zukunft, wenn man Entscheidungen trifft und kommuniziert? Ist es in erster Linie Motivation durch Bedrohung oder Inspiration durch Chancen?
- Schaffe Raum für deine Teams, um positive Zukunftsperspektiven zu erkunden. Das bedeutet nicht, Herausforderungen zu ignorieren, sondern Risikobewusstsein und Chancenorientierung in Einklang zu bringen.
Auf der Grundlage kritischer Zukunftsforschung und umfangreicher praktischer Erfahrung arbeite ich mit Organisationen zusammen, um über die traditionelle strategische Planung hinaus zu einem differenzierteren und effektiveren Engagement für zukunftsorientiertes Denken zu gelangen. Gemeinsam können wir diesen mächtigen Hebel für die Organisationsentwicklung in eurem Kontext nutzen.