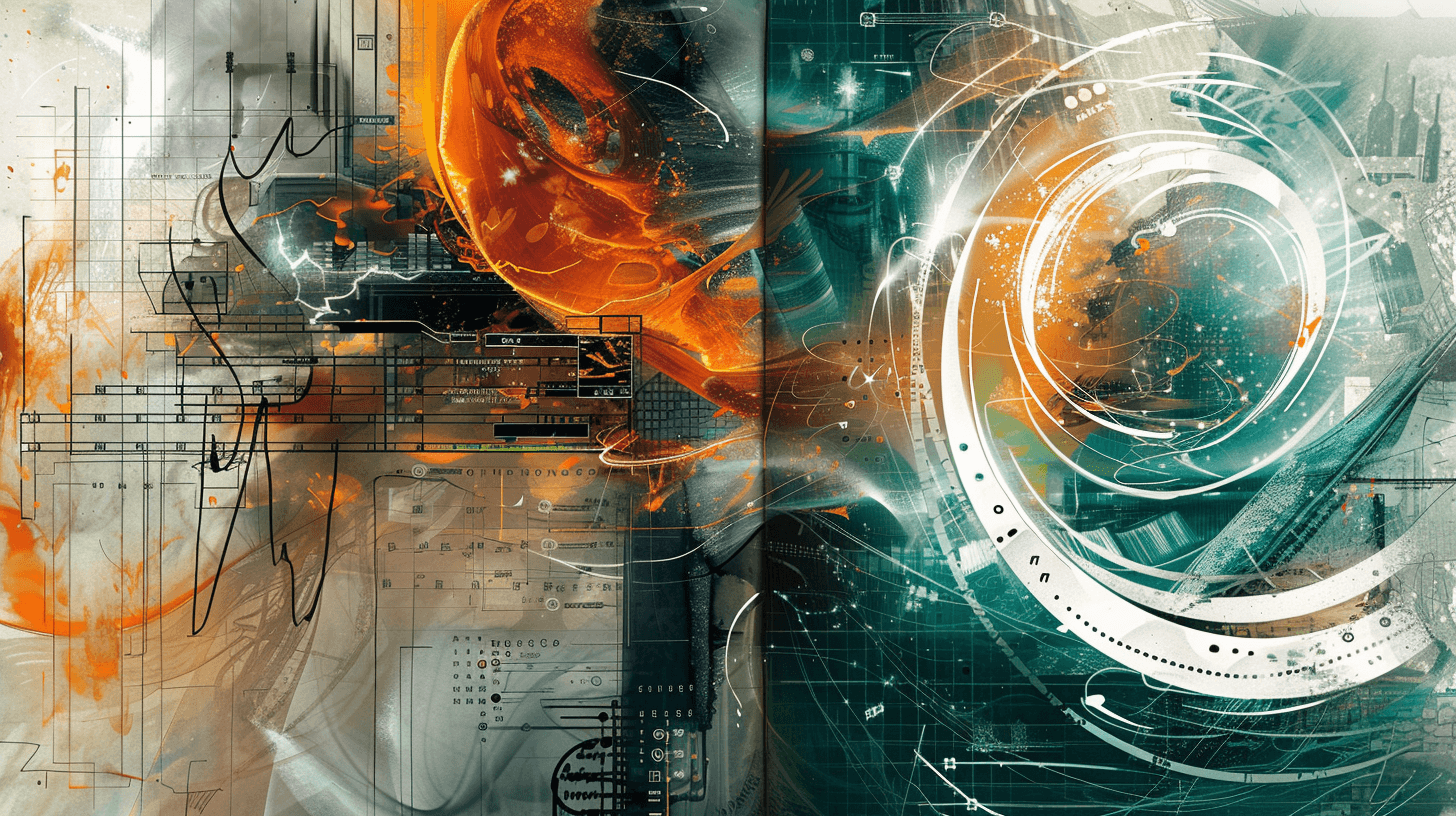This article is also available in: English
Durch zukunftsorientiertes Denken die reale Welt beeinflussen
Als Foresight-Experte mit mehr als zehn Jahren Erfahrung habe ich ein immer wiederkehrendes Problem in unserem Bereich festgestellt: die mangelnde Wirksamkeit unserer Arbeit. Lassen Sie mich eine typische Situation schildern:
Die Szenarien sind fertig. Vielleicht hast du sogar schon eine Rückwärtsplanung durchgeführt. Der Bericht ist geschrieben, inklusive einer schönen Präsentation mit den wichtigsten Erkenntnissen. Du hast die Abschlusspräsentation gehalten. Der Kunde ist zufrieden. Die Rechnung ist bezahlt. Und dann … passiert nichts. Du meldest dich beim Kunden und fragst, wie es ihm mit all den Erkenntnissen und Empfehlungen geht, und sie erzählen von einigen kurzfristigen Prioritäten, die an Bedeutung gewonnen haben, und dass sie immer noch auf das Treffen mit dem CEO warten, und dass sie kurz davor stehen, in eine andere Abteilung versetzt zu werden, aber dass sie sich immer noch gerne an unser Projekt erinnern und wie viel Spaß es ihnen gemacht hat.
Dieses Szenario veranschaulicht ein häufiges Problem des Foresight-Prozesses: die Diskrepanz zwischen den Erkenntnissen, die wir liefern, und ihrer praktischen Umsetzung. Wenn man sich die Arbeit einer Organisation als einen großen, umfassenden Prozess vorstellt, der von der Vorausschau (Was könnte auf uns zukommen?) über die Strategie (Wie kommen wir dorthin?) bis hin zur Taktik und Umsetzung (Was kommt als Nächstes?) reicht, dann gibt es eine große Lücke zwischen Vorausschau und Strategie.
Ein Faktor, der zu dieser Kluft beiträgt, ist die Struktur und Ausrichtung der Strategieabteilungen vieler Organisationen. Diese Abteilungen arbeiten oft unter Einschränkungen, die es schwierig machen, die Erkenntnisse der Vorausschau in vollem Umfang zu nutzen. Sie können unterbesetzt sein, nicht genügend Wertschätzung erfahren oder sich hauptsächlich auf kurzfristige Horizonte konzentrieren – in der Regel auf das nächste Quartal oder Geschäftsjahr und nicht auf die langfristige Zukunft. Infolgedessen fehlt es ihnen häufig an Ressourcen, Reichweite oder Mandat, um die Erkenntnisse der Zukunftsforschung effektiv zu integrieren und entsprechend zu handeln. Diese Herausforderung wird in Organisationen noch verschärft, in denen nicht einmal klar ist, welche Abteilung oder welches Team für die Umsetzung der Erkenntnisse aus der Foresight-Analyse verantwortlich ist.
Als Zukunftsforscher tragen wir aber auch eine große Verantwortung für die mittelmäßige Wirkung unserer Arbeit. Wir denken viel über den Prozess der Entwicklung unserer Szenarien und Empfehlungen nach, aber dann werfen wir sie über den Zaun der Organisation und machen weiter. Ich bekenne mich schuldig. Ich habe in den letzten zehn Jahren viele Zukunftsreports und Szenarioprojekte erstellt – eine Arbeit, auf die ich wirklich stolz bin. Aber wenn ich mir anschaue, wie wenig Einfluss sie am Ende hatten, dann ärgert mich das. Und wenn ich mir unsere Branche anschaue, dann sehe ich, dass ich nicht allein bin. Die geringe Wirkung, die wir haben, hat auch wirtschaftliche Folgen. Trendagenturen und Designstudios müssen ständig neue Kunden gewinnen, weil die alten nicht wiederkommen, um neue Aufträge zu vergeben. Hätte unsere Arbeit die Wirkung, die wir uns erhoffen, wäre sie nicht das erste, was in schwierigen Zeiten aus dem Budget gestrichen würde.
Um diesen Herausforderungen zu begegnen und die Wirkung der Zukunftsforschung zu erhöhen, müssen wir unseren Ansatz von Beginn eines Projekts an überdenken.
Der Anfang von Foresight: Kritische Fragen
Zu Beginn eines Foresight-Projekts kommt der Kunde mit einer Frage oder einem Ziel. Im Wesentlichen möchte er eine Entscheidung treffen können, sei es über den weiteren Weg, die Wahl einer Strategie oder einer Investition oder ganz allgemein darüber, was auf ihn zukommen könnte. Bevor man sich jedoch über das Budget und den Prozess einig wird, ist es hilfreich, eine Reihe von Fragen zu stellen:
Über das Projekt
- Welches Verständnis hat der Kunde derzeit von dem Problem oder Thema, das er untersuchen möchte?
- Gibt es alternative Betrachtungsweisen, die zu anderen Ergebnissen führen?
- Was sind die Grenzen des Themas und sind sie für die Bedürfnisse des Kunden angemessen?
- Welcher Zeithorizont wird betrachtet und ist er adäquat für das Thema?
- Wie wird der Kunde den Erfolg des Foresight-Projekts messen?
Über den Kontext
- Welche konkreten Ereignisse oder Trends haben diese Initiative zur Zukunftsforschung ausgelöst?
- Welche internen und externen Faktoren beeinflussen die Kundenperspektive?
- Auf welche Informationsquellen stützt sich der Kunde und sind diese ausreichend vielfältig?
Über den Kunden
- Welche Erfahrungen hat die Organisation in der Vergangenheit mit Foresight-Projekten und deren Umsetzung gemacht?
- Wie offen ist die Organisation, ihre bisherigen Sichtweisen in Frage zu stellen und disruptive Veränderungen in Betracht zu ziehen?
- Wer sind die wichtigsten Stakeholder in diesem Projekt und wie sehen ihre Entscheidungszyklen aus?
All diese Fragen helfen dir, das Briefing des Kunden zu entschlüsseln und besser zu verstehen, was er sucht.
Eine weitere Reihe von Fragen untersucht die zugrunde liegenden Annahmen und unbewussten Vorurteile über die Zukunft, die jede Organisation hat und die man als ihre Zukunftskultur zusammenfassen könnte.
Zur Zukunftskultur des Kunden
- Welche Rolle spielt die Zukunft in der Strategie und den Prozessen der Organisation?
- Wie koexistieren „offizielle“ und „versteckte“ Zukunftserzählungen in der Organisation?
- Welches Spektrum an Zukunftsszenarien ist die Organisation bereit in Betracht zu ziehen und welche sind tabu?
- Wie geht die Organisation normalerweise mit Risiken und Unsicherheiten um?
In den meisten Foresight-Projekten wird diese Zukunftskultur eines Kunden nie skizziert. Sie wird in der Regel erst dann deutlich, wenn etwas im Foresight-Projekt dagegen spricht und es plötzlich starken Widerstand gibt, z.B. wenn man einem Manager Zwischenergebnisse präsentiert und dieser ohne ersichtlichen Grund wütend wird.
Deshalb ist es so hilfreich, die Zukunftskultur einer Organisation zu Beginn eines Projekts herauszuarbeiten. Es gibt aber noch eine Reihe weiterer Fragen, die zu Beginn eines Foresight-Projekts gestellt werden sollten.
Über die Umsetzung
- Wie will der Kunde die Ergebnisse dieses Foresight-Projekts umsetzen?
- Welche Prozesse und Ressourcen stehen zur Verfügung, um auf die Erkenntnisse der Zukunftsforschung zu reagieren?
- Welche möglichen Hindernisse gibt es bei der Umsetzung der Projektergebnisse?
Wie diese Fragen zeigen, ist es sehr hilfreich, das Projekt so zu planen, dass die größtmögliche Wirkung und Durchführbarkeit erreicht wird. Mit anderen Worten: Denke an das Ende des Foresight-Projekts.
Um diese Reihe von Fragen weiter zu entwickeln, habe ich meinem digitalen Garten eine Notiz hinzugefügt.
Das Ende von Foresight: Nach dem Schlussbericht
Da wir uns dem Ende eines Foresight-Projekts nähern, müssen wir strategisch darüber nachdenken, wie wir seine Wirkung maximieren können. Ich schlage vor, dies auf drei Ebenen zu tun:
- Auf der untersten Ebene werden Maßnahmen geplant, die sich an die Vorlage des Abschlussberichts oder eines anderen Endergebnisses anschließen. Dies könnte z.B. eine interne Roadshow sein, bei der die Ergebnisse verschiedenen Teilen der Organisation vorgestellt werden. Jeder Teil würde eine kontextualisierte Version der Ergebnisse erhalten, um zu verdeutlichen, wie sich die erwarteten Zukunftsszenarien auf sie auswirken könnten. Dies könnte mit einem Workshop kombiniert werden, um dem Publikum zu helfen, die Empfehlungen gemeinsam durchzuarbeiten und ihre eigenen nächsten Schritte und zukünftigen Projekte abzuleiten. Für unsere Arbeit mit dem SWR an einem Zukunftsbericht über die Medienlandschaft haben wir zum Beispiel auch verschiedene Workshop-Designs entwickelt, damit das Kundenteam mit verschiedenen Abteilungen zusammenarbeiten kann, um die Ergebnisse des Berichts auf ihren Kontext anzuwenden, von Redaktionsteams, die über die Bedürfnisse ihres zukünftigen Publikums nachdenken, bis hin zu technischen Abteilungen.
- Die mittlere Ebene unterstützt die Organisation beim Übergang von einem einmaligen Foresight-Projekt zu einem kontinuierlichen Foresight-Engagement. Anstatt den Bericht einfach zu übergeben, wird ihnen gezeigt, dass sie Trends und Szenarien regelmäßig überprüfen müssen, damit Foresight einen größeren Einfluss auf ihre Organisation hat. Die Welt verändert sich ständig und sie müssen sich anpassen. Voraussetzung für diese Ebene ist, dass die Basisebene bereits etabliert ist und Ergebnisse vorweisen kann. Wenn der Kunde noch nicht sicher ist, ob sich das Foresight-Projekt gelohnt hat, wird es schwierig sein, grünes Licht für ein laufendes Projekt zu geben. Wenn jedoch das Feedback aus verschiedenen Abteilungen zeigt, dass die Arbeit mit den Projektergebnissen nützlich war, ist es einfacher, den Fall zu verteidigen.
- Auf der letzten Ebene sehe ich eine stärkere Überschneidung zwischen Foresight und Organisationsentwicklung. Schließlich liegen die Herausforderungen bei der Umsetzung der Erkenntnisse und Empfehlungen aus der Zukunftsforschung auf der Ebene der Organisationsgestaltung. Organisationen sind nicht darauf ausgelegt, mit unterschiedlichen Zukunftsszenarien umzugehen. Sie verfügen in der Regel nicht über die dafür notwendigen Positionen und Prozesse. Deshalb fällt es ihnen schwer, sich an Veränderungen anzupassen und mit neuen Entwicklungen von der Klimakrise bis zur künstlichen Intelligenz umzugehen. In gewisser Weise macht die Zukunftsforschung dieses Grundproblem sichtbarer, ohne es lösen zu können. Deshalb interessiere ich mich sehr für die Schnittstelle zwischen Zukunftsforschung und Organisationsentwicklung.
Für mich sind diese Ebenen nur eine Ausgangshypothese, um weiter zu erforschen, wie wir die Lücke zwischen Zukunftsforschung und dem Rest einer Organisation schließen können. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Design eine entscheidende Rolle dabei spielen kann, die Zukunft greifbarer zu machen. Aber das ist noch nicht alles.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir, um die Wirkung der Zukunftsforschung zu erhöhen, sowohl über den Anfang als auch über das Ende unserer Projekte kritisch nachdenken müssen. Indem wir von Anfang an die richtigen Fragen stellen und die Umsetzung von Anfang an planen, können wir die Lücke zwischen Vorausschau und Handeln schließen. Als Praktiker tragen wir die Verantwortung dafür, dass wir mit unserer Arbeit nicht nur Zukünfte entwerfen, sondern diese auch mitgestalten. Ich lade euch ein, eure Erfahrungen und Ideen darüber auszutauschen, wie wir die Zukunftsforschung effektiver gestalten können.